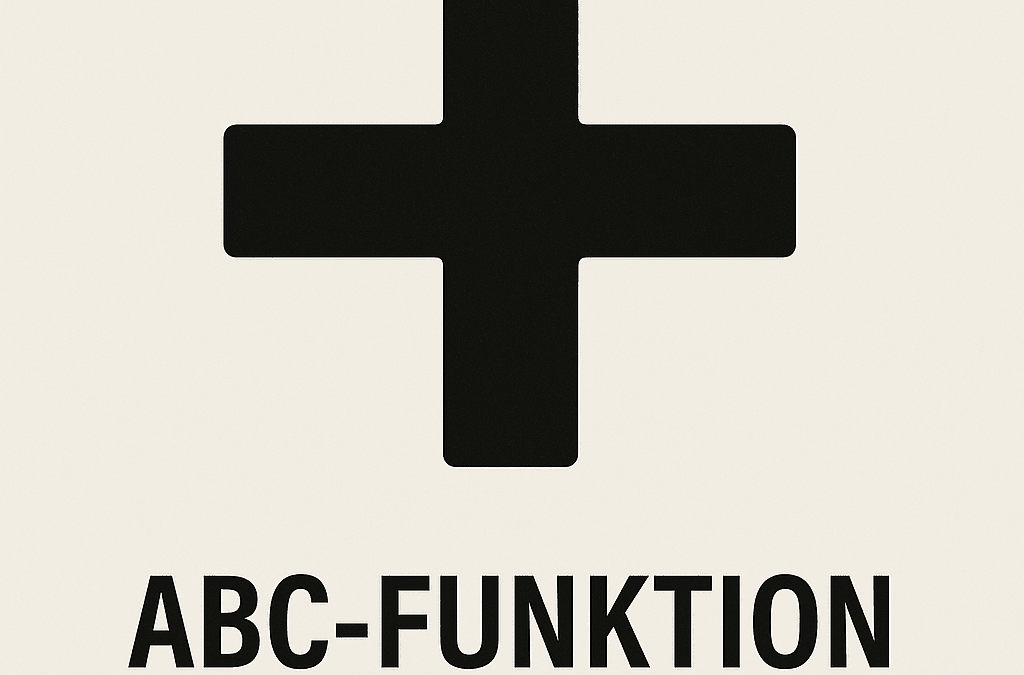Effektive Veränderungsarbeit nach Grawe und Roth – ein Praxisfall aus der Coachingarbeit
Wissenschaftlich fundierte Veränderung: Die fünf Schritte nach Klaus Grawe
Der renommierte Berner Psychologieprofessor Klaus Grawe (1943–2005) hat in seinem Werk Neuropsychotherapie (2004) fünf zentrale Schritte wirksamer Veränderungsarbeit beschrieben, basierend auf einer umfassenden Metastudie. Diese Schritte sind nicht nur psychologisch sinnvoll, sondern auch neurobiologisch wirksam – wie der Hirnforscher Prof. Gerhard Roth (1942–2023) mittels bildgebender Verfahren bestätigen konnte:
- Aufbau einer therapeutischen Allianz
- Aktivierung des Problemzustands
- Klärung der Motivation
- Aktivierung von Ressourcen
- Verknüpfung von Problem- und Ressourcenzustand
Veränderung gelingt nach Roth nur, wenn sie auch im Gehirn Spuren hinterlässt – sprich: wenn Lernen stattfindet.
Schritt 1: Die therapeutische Allianz – Vertrauen als Fundament
Der erste Schritt ist essenziell: die Schaffung einer tragfähigen Beziehung zwischen Coach/Therapeut und Klient. Vertrauen wirkt dabei in mehrere Richtungen. Gerhard Roth nennt drei Voraussetzungen:
- Der Klient muss glauben, dass der Coach helfen kann.
- Der Coach muss überzeugt sein, helfen zu können.
- Beide müssen an die Wirksamkeit der Methode glauben.
Erst wenn diese Allianz steht, kann der nächste Schritt folgen: die gezielte Aktivierung des Problemzustands.
Schritt 2: Den Problemzustand gezielt aktivieren – nicht nur darüber reden
Viele Interventionen bleiben oberflächlich, wenn lediglich über das Problem gesprochen wird. Eine echte emotionale Aktivierung geschieht jedoch erst, wenn der Klient in eine konkrete Szene eintaucht, in der das Problemverhalten auftritt – idealerweise mit allen Sinnen.
Wer im NLP ausgebildet ist, kennt das Prinzip der wohlgeformten Ziele: Der Klient wird in eine Problemszene geführt, aktiviert seine Sinneswahrnehmung und formuliert ein Ziel. Die dabei entstehenden Gefühle – insbesondere negative – zeigen, dass der Problemzustand aktiviert ist.
In diesem Blog-Beitrag möchte ich ein von mir verwendetes Vorgehen beschreiben, das die Prinzipien der Mentalen Raum Psychologie (MSP) nutzt. Ich wende es sehr erfolgreich in meiner Praxis an. Man kann auf diese Weise den emotionalen Kontext sehr präzise herausarbeiten und aktivieren, um danach – mit welchem Verfahren auch immer – in die Problemlösung zu gehen. Natürlich idealerweise unter Nutzung der MSP!
Praxisbeispiel: Veränderungsarbeit mit Rudi Neubauer
Rudi Neubauer ist Unternehmer und führt seit Jahren allein ein Geschäft, das er einst mit seinem Kompagnon Dieter aufgebaut hat. Dieter ist seit fünf Jahren krank, möchte aber weiterhin mitreden und am Gewinn beteiligt sein – ohne aktive Mitarbeit. Rudi fühlt sich gebunden, blockiert und emotional überfordert.
Sein Ziel: eine klare Verhandlung mit Dieter, um das Unternehmen eigenständig weiterführen zu können.
Rudi beschreibt seine Lage so:
„Ich führe das Geschäft seit fünf Jahren allein. Dieter will mitreden, blockiert neue Wege und beansprucht Gewinnanteile. Gleichzeitig herrscht Funkstille – er lebt 100 km entfernt. Ich fühle mich wie an einen Kadaver gebunden. Ich bin festgefroren und fühle mich total verarscht.“
Wir haben folgende Verhaltensweisen von Rudi herausgefunden:
- Ich mache Dinge, die andere wollen und nicht das, was ich will.
- Ich bin Dieter nicht gewachsen.
- Ich stelle meine Interessen zurück.
Die Funktion des Problemverhaltens – ein MSP-Ansatz
In meiner Arbeit mit Rudi habe ich das Problemverhalten als mentale Funktion definiert. Diese Funktion ist autonom und unbewusst, sie verarbeitet Sinneseindrücke und erzeugt ein spezifisches Gefühl, das das Problemverhalten auslöst.
Funktionsdefinition:
| Eingang |
|
| Verarbeitung |
|
| Ausgabe |
|
Durch die gemeinsame Definition dieser Funktion erkennt der Klient: Ich tue das selbst – also kann ich es auch verändern.
Symbolarbeit im mentalen Raum
Der nächste Schritt war, der Funktion einen Namen zu geben. Das Brainstorming ergab folgende Liste:
- Eigenständigkeitsverhinderungs-Funktion
- Gefahrenabwehr Funktion
- Schmerzvermeidungsfunktion
- Befreiungs-Funktion
Rudi wählte am Ende eine pragmatische Bezeichnung. Für ihn war es schlicht die ABC-Funktion. Diese Bezeichnung war für ihn stimmig. Danach wählte Rudi noch ein metaphorisches Symbol, das die ABC-Funktion repräsentierte. Er wählte eine fettes PLUSZEICHEN.
In einer typischen Problemszene visualisierte er das Symbol: schräg rechts über ihm, schwer und belastend. Er meinte dazu: „ich kann dem nicht ausweichen“. Die körperliche Reaktion – Schwere im rechten Arm – zeigte: Der Problemzustand war emotional und körperlich aktiviert.
Schritt 3 bis 5: Motivation, Ressourcen und Transformation
Diese Aktivierung ist der Schlüssel zur weiteren Arbeit: Dieses Gefühl, das das Problemverhalten motiviert, ist nun greifbar. Der Klient hat gelernt, dieses Gefühl unbewusst zu vermeiden oder zu verstärken. Es ist ein Motov! Wir sind also bereits bei Schritt 3 der wirksamer Veränderungsarbeit angekommen.
Wir haben dann weitere Motivaspekte geklärt, Ressourcen gefunden, getestet und verwoben. So wurde das Problemgefühl in ein gutes Gefühl transformiert.
Wie genau? Dafür gibt es viele Wege. Vielleicht stelle ich einen davon im nächsten Newsletter vor. Lassen Sie sich am besten zu den hochwirksamen Techniken der MSP ausbilden.
Was wirkt?
Die Mentale Raum Psychologie ist die Wissenschaft der Veränderung von Beziehungen. Probleme sind immer schlechte Gefühle – und Gefühle entstehen aus Beziehungen. Diese Beziehungen bestehen nicht nur zu Menschen, sondern auch zu Dingen, Orten, Symbolen.
Die Kunst des Coaches oder Therapeuten besteht also darin, mit der „richtigen“ Beziehung zu arbeiten. Die meisten Methoden arbeiten mit der Beziehung zum Problem. Ich arbeite mit der Beziehung zum Problemverhalten. Wird diese verändert, verändert sich auch die Beziehung zum Problem!
Sie glauben das nicht? Dann probieren Sie es aus!
Lassen Sie sich in den hochwirksamen Techniken der MSP ausbilden – für nachhaltige Veränderung, die wirkt.